Kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert wie Fleisch. Neben gesundheitlichen Aspekten spielen dabei vor allem ökologische Aspekte eine wichtige Rolle. Bei uns kommen verschiedene Akteurinnen und Akteure zu Wort, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf Fleisch und auch die Fleischproduktion blicken.
Die Beiträge wurden vom Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) eingeholt.
Inhalt
- Wer redet wie über Fleisch?
- Ist Fleischverzicht wirklich gut für die Gesundheit?
- Wie sieht ein respektvoller Umgang mit Fleisch aus?
- Fleischverzicht für die Umwelt – geht diese Rechnung auf?
- Wie kann der Fleischkonsum der Zukunft aussehen?
- Ist es in Zukunft möglich, herkömmliches Fleisch durch In-vitro-Fleisch zu ersetzen?
- Tierhaltung und Fleischerzeugung als essentieller Teil einer kreislauforientierten und bäuerlich strukturierten Landwirtschaft
Wer redet wie über Fleisch?

Prof. Dr. Gunther Hirschfelder
Professor für Vergleichende Kulturwissenschaft
Universität Regensburg
Es gibt mehrere Fraktionen, die über Fleisch reden:
Für die Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegungen ist Fleisch ein Problemfall und Ursache für den Klimawandel. Manchmal wird es in diesem Zusammenhang auch verkürzt zur Metapher für alles, was schiefläuft. Es gibt Menschen, die haben Flugscham überwunden, geißeln aber den Fleischkonsum anderer. Und es gibt durchaus Organisationen, die dieses Aufregungsnarrativ mit Kampagnen befeuern.
Dann haben wir die Fleischkenner: Sie essen gerne Fleisch und sprechen darüber. Diese Gruppe spaltet sich nochmal auf. Für „Konsumfreaks“ spielt Nachhaltigkeit keine Rolle, die schmecken auch nicht genau hin. Ein Beispiel ist das vergoldete Steak, das sich der Fußballer Franck Ribéry zum Jahreswechsel 2019 gönnte. Die „Genussfreaks“ dagegen sagen, „ein nachhaltig hergestelltes Stück Fleisch aus der Region in einem regionalen Gasthof ist in der Gesamtbilanz besser als Gojibeeren, Mandelmilch oder Avocado aus Peru“.
Und natürlich redet die Industrie über Fleisch und bewirbt ihre Produkte. In den Ernährungswissenschaften wird erstaunlich wenig darüber diskutiert – da scheint es eine Art Common Sense zu geben, dass Fleisch in Maßen Teil einer ausgewogenen Ernährung sein kann, aber aufgrund der Umweltfolgen der Konsum reduziert werden sollte.
Warum ist Fleisch so ein Politikum?
In der Debatte um Fleisch gibt es klare Positionen. Fleisch wird zum Symbol für ökologische Lebensweisen auf der einen und konsumorientierte Lebensweisen auf der anderen Seite. Umweltzerstörung, Tierleid und nachlässiger Umgang mit dem Körper stehen gegen Genuss, Tradition und landwirtschaftliche Produktionsweisen. Es fehlen die Grautöne: Wie könnte eine moderne, tierorientierte Ernährung und Landwirtschaft aussehen? In der aktuellen Politik wird das Thema wenig diskutiert, weil es zu aufgeladen ist.
Wenn wir so weiter produzieren und konsumieren, werden wir auf der Welt in absehbarer Zukunft so nicht mehr leben können. Wir Europäer sitzen in der Falle: Selbst, wenn wir weniger Fleisch essen – der globale Fleischkonsum steigt.
Warum fällt es so schwer, zu verzichten?
Fleisch ist ein Elitendiskurs, der viele Teile der Bevölkerung überhaupt nicht erreicht. Menschen in der sozialen oder räumlichen Peripherie interessieren sich nicht für diese Debatte; für sie ist Fleisch Symbol für Wohlstand, Genuss, Heimatküche.
Zudem gibt es eine genetisch bedingte Vorliebe, wir sind konditioniert auf das Mundgefühl. Seit den frühen Hominiden über alle Kulturen hinweg war der Zugriff auf tierisches Protein ein Merkmal für die Stellung einer Person in der Gesellschaft. Heute empfinden viele Essen als einen der letzten unregulierten Bereiche. Die Lust am Fleischexzess kann man zum Beispiel bei All-inclusive-Angeboten oder Grillevents beobachten.
In der Ernährungsbildung werden diese emotionalen Komponenten noch zu wenig beachtet – wir dürfen nicht nur Verzicht predigen!
Ist Fleischverzicht wirklich gut für die Gesundheit?

Dr. Evelyn Medawar
Neurowissenschaftlerin und Expertin für pflanzenbasierte Ernährung
PAN (Physicians Association for Nutrition) – Regional Office DACH
Aus neurowissenschaftlicher Sicht zeigt sich zunehmend, dass unsere Ernährung nicht nur Herz und Kreislauf, sondern auch das Gehirn maßgeblich beeinflusst.Eine sehr groß angelegte Langzeitstudie mit über 133.000 Teilnehmenden, veröffentlicht im Fachjournal Neurology, hat kürzlich gezeigt: Ein hoher Konsum von rotem, insbesondere verarbeitetem Fleisch, ist mit einem erhöhten Demenzrisiko und schlechterer kognitiver Funktion verbunden. Studien wie diese liefern starke Hinweise darauf, dass eine weniger fleischlastige Ernährung – und im Gegensatz eine gesunde, ausgewogene reich an Ballaststoffen, Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen – unser Gehirn langfristig schützen kann.
Zudem spielt der Darm eine Schlüsselrolle: Ein gesunder Darm mit vielfältiger Mikrobiota beeinflusst nicht nur die Immunabwehr, sondern auch unser emotionales und kognitives Gleichgewicht über die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Ballaststoffe aus pflanzlicher Kost nähren diese „guten“ Bakterien, während der Verzehr von rotem Fleisch Entzündungsprozesse fördert, die über den Darm auch das Gehirn betreffen können. Ein erhöhter Fleischkonsum wird oft mit einem erhöhtem Darmkrebsrisiko und anderen Krebsarten wie Speiseröhrenkrebs in Verbindung gebracht.
Mehr Infos zum Thema gibt es im Forschungsstand zum Mikrobiom.
Warum fällt es vielen Menschen schwer, auf Fleisch zu verzichten?
Ernährung ist weit mehr als bloße Nahrungsaufnahme – sie stiftet Sinn, Zugehörigkeit und soziale Struktur. Wenn wir unsere Essgewohnheiten infrage stellen, stellen wir oft auch unsere Rolle in einem sozialen Gefüge infrage. Ein Familienrezept, ein Grillabend mit Freunden – das alles ist mit Emotionen und Identität verknüpft.
Außerdem deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass auch unser Mikrobiom – also die Gesamtheit der Darmbakterien – unser Verlangen mitsteuern kann. Wer regelmäßig tierische Produkte isst, „füttert“ bestimmte Bakterienstämme, die wiederum unsere Vorlieben beeinflussen könnten. Das macht eine Veränderung nicht nur psychologisch, sondern auch biologisch herausfordernd. Aber: Der Darm ist trainierbar – und damit auch unser Geschmack und unser Wohlbefinden.
In meiner eigenen Studie im Rahmen meiner Doktorarbeit haben wir analysiert, inwiefern Ballaststoffsupplementierung sich nicht nur auf den Darm, sondern auch auf Essentscheidungen auswirkt. Wir konnten feststellen, dass auf neuronaler Ebene bestimmte Belohnungsignale im Gehirn sich nach zwei Wochen Ballaststoffzugabe veränderten, hin zu: Weniger Belohnungsignal für sehr hoch kalorische Lebensmittel.
Wie sieht ein respektvoller Umgang mit Fleisch aus?

Christoph Grabowski
Fleischermeister, Fleischsommelier, Dozent an der Fleischerschule Augsburg, Teamleiter Fleisch bei Niggemann Food Frischemarkt
Wertschätzung sollte für alles gelten, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Ein Problem beim Fleisch ist, dass es in den letzten Jahrzehnten zunehmend anonymisiert wurde. Vor 20 Jahren waren die Fleischereien Teil der Nahversorgung. Jetzt nimmt man im Discounter das Fleisch aus der Kühltruhe – dadurch geht der Wert und der Respekt vor dem Tier verloren, weil wir es als Produkt sehen und nicht als Lebewesen. Qualität und Geschmack sind standardisiert.
In Bayern und Baden-Württemberg befinden sich etwa die Hälfte aller deutschen Handwerksmetzgereien; der Rest verteilt sich auf 14 Bundesländer. Für mich ist das Fleischhandwerk von morgen Kulturgut, das wir den Menschen näherbringen müssen. Mein Credo ist: Wertschätzung durch Wertschöpfung. Wir sollten wieder das ganze Tier essen.
Großbetriebe können weltweit verkaufen; die Handwerksmetzgereien, die noch selbst schlachten, haben diese Möglichkeit nicht und müssen ihre Produkte entsprechend teurer verkaufen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist allerdings: Wir brauchen eine Grundversorgung, um die Bevölkerung in Deutschland zu ernähren!
Mir liegen alte Rassen am Herzen. Ich bin zum Beispiel Fan von Mangalitza-Schweinen. In den Großschlachthöfen können sie nicht mehr geschlachtet werden, da sie nicht die erforderlichen Standardmaße haben. Aber ein Schweinekotelett vom Mangalitza schmeckt ganz anders als vom Hybrid-Schwein.
Was muss passieren, um mehr Wertschätzung für Fleisch zu erreichen?
Zunächst sollten wir versuchen, eine vernünftige, praktische und fachliche Diskussion zu führen. Wir sollten nicht über Fleisch- oder VeganesserInnen herziehen, dies wäre der falsche Ansatz. Ich bin überhaupt kein Freund davon, den Verbraucherinnen und Verbrauchern vorzuschreiben, was sie zu essen haben. Die Menschen wissen schon gar nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen.
Wir werden es auch nicht schaffen, wenn wir Fleisch weiterhin anonymisieren und verpackt in ein Regal stellen. Ich würde mir wünschen, dass im Restaurant Fleisch auf der Karte so beschrieben wird wie Wein oder Bier. Rotwein kann ein einfacher Tafelwein sein, aber daneben gibt es so viele Sorten: Montepulciano, Rioja, Bordeaux… Beim Fleisch steht da meistens nur Schnitzel oder Roastbeef. Überall gibt es Kennzeichnungen, gerade in der Gastronomie oder in Kantinen; warum nicht auch beim Thema Fleisch? Ich wüsste gerne, ob ich ein Hähnchenfilet aus Brasilien oder aus Deutschland esse. Wenn man Parmaschinken kauft oder Iberico-Schinken hat, hat man sofort einen hochwertigen Preis im Kopf – warum nicht auch beim Schwarzwaldschinken?
Fleischverzicht für die Umwelt – geht diese Rechnung auf?
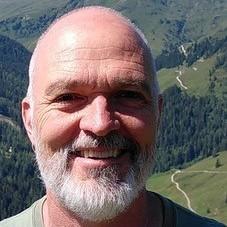
Prof. Dr. Werner Zollitsch
Professor für Nutztierwissenschaften,
Leiter des Zentrums für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit;
Universität für Bodenkultur Wien
Für die Länder des „Globalen Nordens“ mit sehr hohem Fleischkonsum geht diese Rechnung jedenfalls auf. Wenn wir weniger Fleisch essen und damit die Produktion auf rund die Hälfte des derzeitigen Niveaus drosseln, hätte das sehr positive Umwelteffekte.
Weniger Emissionen von Treibhausgasen, Ammoniak und Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor bedeuten: Die Auswirkungen des Klimawandels werden abgeschwächt, der pH-Wert von Böden und Gewässern bleibt ausgewogen und wir verhindern eine Überdüngung von Oberflächen- und Grundwasser mit Nitrat und Phosphor, die sogenannte Eutrophierung. Weiter würden wir weniger Ressourcen wie Energie, Boden oder Wasser verbrauchen und erhalten Biodiversität.
Sollten wir ganz auf Fleisch verzichten?
Ein vollständiger Fleischverzicht ist aus Umweltsicht nicht nötig! Die beiden entscheidenden Faktoren sind die Höhe des Fleischkonsums und die Art der Produktion. So führt die Haltung von Wiederkäuern wie Rindern und Schafen zwar zu höheren Treibhausgas-Emissionen. Diese Tiere verwerten aber regional vorhandene Futter-Ressourcen, die nicht für die menschliche Ernährung geeignet sind und erzeugen daraus Milch, Fleisch und nicht zuletzt Dünger in Form von Mist und Jauche.
Solche extensiven Systeme können natürliche Kreisläufe und damit Biodiversität erhalten – sie liefern aber auch deutlich geringere Mengen an tierischen Lebensmitteln, als wir heute haben. Die intensive Erzeugung von Geflügel- und Schweinefleisch schneidet im Vergleich meist schlechter ab: Erstens besteht eine Nahrungskonkurrenz, denn diese Tiere benötigen Futtermittel, die teilweise für den menschlichen Konsum geeignet wären. Zweitens leidet häufig das tierische Wohlbefinden in diesen Haltungsformen.
Aktuelle Empfehlungen raten zu rund einem Drittel des heutigen Fleischkonsums; das brächte auch gesundheitliche Vorteile. Aus Nachhaltigkeitssicht sehe ich allerdings die Empfehlung von Schweine- und Geflügelfleisch kritisch: Für das Ökosystem sind Wiederkäuer vorteilhafter.
Wie kann der Fleischkonsum der Zukunft aussehen?

Olaf Bandt
Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)
Kontakt über Patrick Müller (Referent für Agrarpolitik und Tierhaltung)
Fleisch trägt unter den jetzigen Produktionsbedingungen in ganz erheblichem Maße zum globalen Ausstoß von Klimagasen bei. So sind nach Zahlen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen etwa zwölf Prozent des menschengemachten Ausstoßes von Klimagasen alleine auf die Tierhaltung zurückzuführen. Etwa zwei Drittel davon entfallen auf Fleisch, knapp ein Drittel auf Milchprodukte.
Dies betrifft insbesondere Wiederkäuer wie Rinder, Schafe und Ziegen, welche in ihrer Verdauung das hochwirksame Klimagas Methan produzieren. Bei der leider inzwischen selten gewordenen Weidehaltung wird ein Teil der Klimagase wieder im Boden gespeichert, in Form von Kohlenstoff im Humus. Die extensive Weidehaltung bietet daher einen starken Beitrag zum Klimaschutz und ist dazu wesentlich tierfreundlicher. Aus Umweltschutzgründen muss der Konsum von tierischen Produkten massiv sinken, der BUND fordert eine Reduzierung um mindestens die Hälfte. Wir wollen nicht auf die Tierhaltung verzichten, auch aus Gründen des Biodiversitätsschutzes nicht – Weidehaltung ist hier unersetzbar!
Der BUND ist sich einig mit der Zukunftskommission Landwirtschaft: In Zukunft sollten wir deutlich weniger Fleisch und andere tierische Produkte essen, außerdem aus anderen Produktionsverfahren als bisher. Der Anteil aus besserer Haltung wie zum Beispiel aus ökologischer Tierhaltung muss erheblich steigen. Unsere Vision für die Landwirtschaft ist der Ökolandbau. Dabei müssen Konsum und Produktion tierischer Produkte natürlich im Einklang sein. Hierfür braucht es dringend bessere Rahmenbedingungen, die es Menschen möglichst leicht macht, sich aus Umwelt- und Gesundheitsgründen stärker pflanzenbasiert zu ernähren.
Insbesondere in öffentlichen Einrichtungen wie in Mensen und Kantinen brauchen wir dafür einen Speiseplan, der sich an der Planetary Health Diet orientiert. Ob dabei In-vitro-Fleisch und andere Formen von sogenannten Ersatzprodukten eine große Rolle spielen werden, wird sich zeigen. Für den BUND als Umweltverband ist dabei besonders wichtig, dass solche Produkte weder mittels Gentechnik hergestellt werden, noch deren Herstellung größere Klima- oder Umweltprobleme verursacht als das tierische Originalprodukt.
Ist es in Zukunft möglich, herkömmliches Fleisch durch In-vitro-Fleisch zu ersetzen?
Arianna Ferrari PhD.
AIT (Austrian Institute of Technology)
Ich bevorzuge die Bezeichnung „zellkultiviertes“ oder „zellbasiertes“ Fleisch. Namen transportieren Werte und Ideen; „in vitro“ klingt so nach künstlicher Befruchtung: Die Zellen werden auf der Petrischale differenziert und wachsen dann in einem Bioreaktor. Im Moment kann man in einigen Ländern zellkultiviertes Fleisch kaufen, aber eine Produktion im großen Stil ist nicht möglich. Dafür braucht es noch Forschung, beispielsweise im Bereich der Bioreaktoren.
Um die Frage zu beantworten, muss man auch die Seite von herkömmlichem Fleisch betrachten. Die Wissenschaft ist sich einig, dass die Tierbestände in Europa zu hoch sind. Von der politischen und praktischen Seite gibt es aber Widerstand gegen die Frage, ob man Tiere reduzieren soll und wie viel.
Am Ende entscheiden politische Zielsetzungen über den Fleischkonsum der Zukunft. Subventionen regulieren, wie viele Tiere es gibt, und Forschungsförderungen ermöglichen die Weiterentwicklung der Technologien für zellkultiviertes Fleisch. Politische Entscheidungen steuern den Preis von herkömmlichem Fleisch und das beeinflusst wiederum die Konkurrenzfähigkeit von zellkultiviertem Fleisch. Eine Innovation ist zu Beginn teurer als das Produkt, das ersetzt oder eingeschränkt werden soll. Wenn sich nichts ändert am Status von herkömmlichem Fleisch, sehe ich nicht, dass zellkultiviertes sich etablieren kann.
Warum sollte die Politik zellkultiviertes Fleisch fördern? Ist es wirklich umweltfreundlicher?
Damit es konkurrenzfähig ist und eine Auswirkung auf die Umwelt hat, muss der Markt von herkömmlichem Fleisch eingeschränkt werden. Ein Szenario, in dem es nur ein Add-On ist und die Produktion von herkömmlichem Fleisch bleibt gleich – das wäre aus Umweltsicht katastrophal. Denn natürlich verbraucht auch die Produktion von zellkultiviertem Fleisch Ressourcen.
In Bezug auf Boden- und Wassernutzung ist zellkultiviertes Fleisch deutlich umweltfreundlicher; beim Strom gibt es Fragezeichen, vor allem bei Rindfleisch. Es müsste grüner Strom verwendet werden, dessen Mengen sind begrenzt und die Politik entscheidet, wie er eingesetzt wird.
Auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht macht es Sinn, den Fleischkonsum in Europa zu reduzieren, wir haben hier einen Überkonsum und eine Überproduktion an Proteinen; aus ethischer Sicht muss sich die Situation der Tiere verbessern. Daher greift das Argument zu kurz: „Wir brauchen die Innovationen, um die steigende Weltbevölkerung zu ernähren.“
Was muss passieren, damit zellkultiviertes Fleisch Teil unseres Alltags wird?
Was sich ändern müsste, ist die Produktion. Gibt es große, zentrale Produktionsanlagen? Was passiert mit den bäuerlichen Betrieben? Eine niederländische Organisation – RESPECTFarms – denkt darüber nach, wie zellkultiviertes Fleisch dezentral auf Bauernhöfen produziert werden kann. Die Arbeit in der Landwirtschaft verändert sich aktuell enorm durch Technologien wie künstliche Intelligenz, Sensorik, Robotik usw. Zellkultiviertes Fleisch geht noch einen Schritt weiter – es ist eine andere Produktionsmethode, die völlig neues Wissen und Technik erfordert. Außerdem brauchen wir eine Debatte über die Art und Weise, wie die dafür benötigten Tiere leben und verwendet werden.
Das Thema „zellkultiviertes Fleisch“ ist sehr komplex, daher sollten alle Interessenträgerinnen und Interessenträger in die Diskussion und die Entwicklung der Ziele einbezogen werden.
Tierhaltung und Fleischerzeugung als essentieller Teil einer kreislauforientierten und bäuerlich strukturierten Landwirtschaft

Landwirtschaft in Bayern besteht aus bäuerlichen Familienbetrieben. Rund zwei Drittel der Betriebe halten Tiere. Bei den ökologisch wirtschaftenden Betrieben sind es sogar knapp 70 Prozent. Mit der Haltung von Tieren und der Erzeugung tierischer Lebensmittel wie Fleisch gelingt es, auch mit den in Bayern überwiegend kleineren Betriebsstrukturen ein ausreichendes Einkommen für eine ganze Familie zu erwirtschaften.
Tierhaltung erfüllt vielfältige Funktionen. Natürlich dient sie in erster Linie der Erzeugung hochwertiger tierischer Lebensmittel. Dabei macht erst die Tierhaltung die 1 Million Hektar Grünland in Bayern über die Mägen des Wiederkäuers (z.B. Rind) für die Erzeugung von Lebensmitteln für den Menschen nutzbar. Zwei Drittel der Betriebe mit Tierhaltung in Bayern halten Rinder.
Aber auch beim Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln spielt die Tierhaltung als Verwerter von nicht essbarer Biomasse eine wichtige Rolle. Immerhin fallen je 1 kg pflanzlichem Lebensmittel 4 kg nicht essbare Biomasse an, die als Tierfutter (z.B. Rapsschrot) genutzt werden können. Außerdem trägt die Tierhaltung entscheidend zum Erhalt der attraktiven und bei Touristen wie Einheimischen gleichermaßen beliebten Kulturlandschaft bei.
Und last but not least: Tierhaltung ist unverzichtbarer Bestandteil einer Landwirtschaft, die in geschlossenen Kreisläufen denkt und arbeitet. Der Kreislauf beginnt beim Anbau von Pflanzen, die ganz oder teilweise an die Tiere verfüttert werden und schließt sich mit der Rückführung von Festmist oder Gülle als organischem Dünger zurück auf Acker- und Grünlandflächen. Gerade die ökologische Landwirtschaft ist darauf angewiesen, über die Tierhaltung wertvollen Wirtschaftsdünger für den Pflanzenbau zu gewinnen.
Fleischkonsum als wertvoller Teil einer ausgewogenen Ernährung
Eine gesunde Ernährung lebt von der Vielfalt – dazu gehören Getreide, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, hochwertige pflanzliche Öle und auch Fleisch. Fleisch liefert dabei wichtige, gut verfügbare Nährstoffe wie Eiweiß, Eisen und B-Vitamine, die zur gesunden Versorgung des Körpers beitragen. Bewusst konsumiertes Fleisch ist ein wertvoller Teil einer ausgewogenen Ernährung und steht für verantwortungsvollen Genuss im Einklang mit Natur, Tier und Mensch.
Mehr rund um Fleisch
Titelbild: Jag_cz/stock.adobe.com
Stand: Mai 2025

